

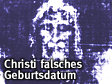
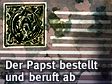
 |
 |
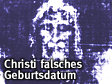 |
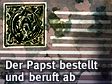 |
News vom 10. Dezember 98 - 16. Dezember 98
Die Krise in der Kirche ist prolongiert: Die mit Spannung erwartete außerordentliche Sitzung der Bischofskonferenz hat in der "Causa Krenn" kein Ergebnis gebracht; die katholischen Oberhirten haben sich am Mittwoch ohne Entscheidung vertagt. "Die Zeit zur grundsätzlichen Besprechung der Probleme war zu kurz", hieß es in einer Stellungnahme. Inzwischen gibt es neue Kritik an Krenn. Schon vor der Sitzung hatte der St. Pöltner Bischof Kurt Krenn via Zeitung alle Rücktrittsaufforderungen an ihn kritisiert.
Wie es in einer veröffentlichten Erklärung heißt, sei es in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen, "die drängenden, anstehenden Probleme in der notwendigen und verantwortbaren Gründlichkeit zu besprechen". Es sei vereinbart worden, "in Kürze" in einem ausführlichen Gespräch die aktuelle Krise zu diskutieren.
Die Bischöfe standen nach den Beratungen für Stellungnahmen nicht zur Verfügung. Sie verließen das Bildungshaus St. Virgil, in dem die Bischofskonferenz getagt hatte, durch den Personalausgang und - damit an den wartenden Journalisten vorbei.
"Wir sind uns des Ernstes der Situation voll bewußt"
Weiter in der Erklärung der Bischofskonferenz: "Wir sind uns des Ernstes der Situation voll bewußt". Wann die Beratungen über die aktuelle Kirchenkrise fortgesetzt werden, stand vorerst noch nicht fest. Ein Termin wurde nicht fixiert. Aber: "Wir haben vereinbart, bis zu diesem Treffen uns aller Kommentare und Äußerungen zu den strittigen Fragen zu enthalten."
Eine weitere Erklärung haben die Bischöfe zum sogenannten 5-Jahres-Bericht im Rahmen des Ad-limina-Besuchs veröffentlicht. Dieser Bericht war der Auslöser des aktuellen Konflikts, nachdem der St. Pöltner Diözesanbischof Kurt Krenn behauptet hatte, der Bericht sei ohne sein Wissen und seine Zustimmung zustande gekommen. In der Erklärung sprechen die Bischöfe dem Sekretariat der Bischofskonferenz ihr volles Vertrauen aus. Das Sekretariat unter der Leitung von Msgr. Michael Wilhelm habe "bei der Erstellung des Berichtes die entsprechenden Beschlüsse der Bischofskonferenz korrekt ausgeführt".
Ein erster Rohentwurf des Berichtes sei bei der heurigen Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe diskutiert worden. Der Klagenfurter Bischof Egon Kapellari sei mit der Endfertigung beauftragt worden. Auch die Erstellung eines Chronikteils sei in dieser Vollversammlung angekündigt worden. "Dabei war klar, daß dieser kalendarische Anhang nicht allen Bischöfen eigens vorgelegt werden mußte."
Zum "Dialog für Österreich"
Eine dritte Erklärung wurde zum "Dialog für Österreich" veröffentlicht. Die Bischöfe betonen darin, daß sie im Rahmen ihres Ad-limina-Besuches die Anliegen der Delegiertenversammlung in Rom zur Sprache gebracht hätten. Bei der außerordentlichen Sitzung der Bischofskonferenz wurden sechs Projektgruppen beschlossen, die zu den wichtigsten Anliegen "pastorale Orientierungen" erarbeiten sollen.
Die Projektgruppe zum Thema "Wiederverheiratete Geschiedene" leitet der Vorarlberger Bischof Klaus Küng, die Gruppe zum Thema "Geistliche Berufe" steht unter Leitung des Wiener Weihbischofs Alois Schwarz. Bischof Kapellari führt die Gruppe zum Themenkomplex "Frauen in Kirche und Gesellschaft", der Innsbrucker Bischof Alois Kothgasser steht an der Spitze der Projektgruppe "Bischofsein heute". Der Linzer Bischof Maximilian Aichern leitet die Projektgrupe "Sonn- und Feiertage", der Eisenstädter Bischof Paul Iby jene zum Thema "Jugend".
"Dialog"-Dokumentation überreicht
Die mit Spannung erwartete außerordentliche Sitzung der Bischofskonferenz hatte Mittwoch pünktlich um 13.30 Uhr begonnen.
Die Sitzung war ursprünglich für nur zwei Stunden anberaumt. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Christoph Schönborn, hatte bereits vor Sitzungsbeginn bekanntgegeben, nach den Beratungen für Journalistenfragen nicht zur Verfügung zu stehen.
Zu Beginn der Konferenz hat der Wiener Weihbischof Alois Schwarz, Leiter der bischöflichen Arbeitsgruppe zum Dialog, seinen Bischofskollegen die ersten Exemplare der Dokumentation von der Delegiertenversammlung in Salzburg Ende Oktober überreicht.
Über die Berufung und Abberufung von Bischöfen.
Der Papst hat die höchste bischöfliche Gewalt über die gesamte römisch-katholische Kirche. Für St. Pölten bedeutet dies wie für viele andere Diözesen auch das freie Ernennungsrecht des Bischofs. Das heißt: Der Papst könnte Kurt Krenn jederzeit abberufen oder versetzen. Die Entscheidung über den Verbleib liegt im freien Ermessen des Papstes.
Rechtlich gesehen gibt es nur eine Grenze: Zum 75. Geburtstag muß jeder Bischof ein Rücktrittsgesuch einreichen. Ob es angenommen wird, liegt aber wiederum im freien Ermessen des Papstes. Krenn (Jahrgang 1936) erreicht am 28. Juni 2011 das bischöfliche Pensionsalter.
Papst an keine Vorgaben gebunden
Bei der Auswahl der Kandidaten ist der Papst an keine Vorgaben gebunden. Es gibt lediglich unverbindliche Beratungsvorgänge. So muß jeder Bischof, die Bischofskonferenz und der Apostolische Nuntius regelmäßig geeignete Personen nennen. Was der Papst damit tut, ist aber seine Sache.
Im Kirchenrecht heißt es zur Ernennung des Bischofs: "Der Papst ernennt den Bischof oder bestätigt den gültig Gewählten." In vielen Diözesen hat nämlich das Domkapitel das Recht, aus einem päpstlichen Dreiervorschlag den Bischof zu wählen. In Österreich trifft dies nur auf Salzburg zu. Im schweizerischen Basel wählt das Domkapitel völlig frei den Bischof - der Papst bestätigt lediglich die Wahl.
Mit der Weihe zum Bischof erreicht ein katholischer Geistlicher nach der Weihe zum Diakon und zum Priester den höchsten Rang im dreistufigen Weiheamt. Diese Weihe kann praktisch nicht mehr rückgängig gemacht werden - nach dem Rechtsgrundsatz: "Semel sacerdos, semper sacerdos" - "Einmal Priester, immer Priester".
Zur Disposition: der Wirkungsbereich
Zur Disposition steht aber der Wirkungsbereich - wie ja auch ein Priester genauso gut Pfarrer einer großen Gemeinde oder Seelsorger in einem Pflegeheim sein kann. So wurde Bischof Jacques Gaillot wegen Unstimmigkeiten mit dem Vatikan und seinen Amtsbrüdern vom französischen Evreux in die nicht mehr existierende Diözese Partenia versetzt. (Diese "Titularbischöfe" werden in der Regel als "Auxiliarbischöfe" anderen Diözesen für Hilfsdienste zugeordnet. Im deutschen Sprachraum werden sie "Weihbischöfe" genannt.)
Der umstrittene Bischof von Chur, Wolfgang Haas, wurde hingegen in die eigens neugeschaffene Erzdiözese Liechtenstein "weg-befördert". Hier gilt der alte Grundatz: "Promoveatur, ut amoveatur" - sinngemäß "Man muß jemanden befördern, damit man ihn los wird."
Krenn zum Rücktritt aufgefordert
Der St. Pöltner Diözesanbischof Kurt Krenn hat - noch vor der Sitzung der Bischofskonferenz - die Forderungen des "Forum Kirchenzukunft" nach seiner Abberufung als "das Allerletzte" kritisiert. Im "Standard" am Mittwoch sagt Krenn: "Wo sind wir denn? Das ist das Allerletzte. Ich kommentiere sie nicht, ich brauche keine Gegenrede"
Krenn zu Rücktrittsforderungen laut "Standard": "Das ist das Allerletzte" - und droht mit Sanktionen gemäß Kirchenrecht.
Krenn: "Habe ich Böses getan? Nein."
Die Rücktrittsaufforderung des Abtes von Stift Göttweig, Clemens Lashofer, an ihn, versteht Krenn nicht. "Ich habe dem Abt immer sehr geholfen". Er werde von Hunderten Menschen gefragt, was er denn angstellt habe. "Habe ich Böses getan? Nein. Man sieht, daß manches nicht paßt". Normalerweise falle das, was er sage, unter Toleranz. "Wenn ich etwas sage, habe ich nicht die Chance, unter die Gnadenordnung der Toleranz zu fallen".
Ob der Apostolische Nuntius Donato Squicciarini über die Konflikte mit ihm gesprochen habe? - Krenn: "Wir reden sehr häufig miteinander. Der Nuntius kennt sich wirklich gut aus. Er weiß Bescheid, er muß von mir nicht informiert werden". Er könne sich nicht daran erinnern, vom Nuntius zur Zurückhaltung aufgefordert worden zu sein, so Krenn.
Den Beratungen der Bischofskonferenz in Salzburg sah Krenn "mit freudiger Erwartung und Offenheit" entgegen. "Wir müssen uns selbst etwas Gutes einfallen lassen. Ich werde sagen, daß die römisch-katholische Kirche römisch-katholisch bleiben muß. Dafür stehe ich. Die anderen Kirchen haben ihre Identitäten, wir müssen unsere Identität bewahren".
Prominente Unterzeichner
Zuletzt hatte sich das "Forum Kirchenzukunft" den Forderungen nach einer Abberufung Krenns angeschlossen. In einem Offenen Brief an den Apostolischen Nuntius in Österreich, Erzbischof Donato Squicciarini, ersuchen die katholischen Experten Papst Johannes Paul II., Krenn als St. Pöltner Bischof abzuberufen. Unterschrieben haben den Brief u.a. der Vorsitzende der Plattform "Wir sind Kirche", Hubert Feichtlbauer, dessen Vorgänger Thomas Plankensteiner, der Präsident der Katholischen Aktion, Christian Friesl, der Prior von Stift Seitenstetten, Michael Prinz, der Sprecher des Priesterrates der Diözese Linz, Walter Wimmer, der Paudorfer Pfarrer Udo Fischer, der Dekan der Theologischen Fakultät der Universität Wien, Johann Figl, sowie die Historikerin Erika Weinzierl.
Friesl hat die Kritik von FPÖ-Klubobmann Ewald Stadler an der Situation der Kirche entschieden zurückgewiesen. Der Präsident der Katholischen Aktion verwahrte sich gegen die Aussage Stadlers, wonach Krenn von einer "Jagdgesellschaft" fertiggemacht werden solle. Dies stelle einen Einmischungsversuch eines Politikers in kirchliche Belange dar. Stadler solle lieber die unqualifizierten Angriffe auf den Sekretär der Bischofskonfernez, Michael Wilhelm, und auf den Wiener Generalvikar Helmut Schüller einstellen.
Auch im "News" bekräftigte Krenn, daß nur der Papst ihn abberufen könne. Zum Vorstoß der niederösterreichischen Äbte Joachim Angerer und Clemens Lashofer, die seinen Rücktritt verlangen, sagte Krenn, dies berühre ihn wenig. "Aber es ist ein Delikt nach dem Kirchenrecht, wenn man die Gläubigen gegen den Ordinarius aufbringt. Der Kodex velangt, dies mit ihrer gerechten Strafe zu belegen. Ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, wenn sie gegen mich hetzen".
Grazer Uni-Vorstand für Rücktritt
Evang. Bischof Sturm: Der Konflikt um Krenn macht einmal mehr deutlich, wie sehr eine "künstliche Autorität" in Gefahr sei, wenn sie nicht "von unten aufgebaut ist".- Theologie-Professor Kolb: "Das Maß ist voll".
Schwerste Kritik am Verhalten von Bischof Kurt Krenn kam am Mittwoch vom Ordininarius des Institutes für Christliche Philosophie der Karl-Franzens-Universität in Graz und Vorsitzenden der Österreichischen Theologischen Kommission (21 Mitglieder), Anton Kolb:
In einem Brief schreibt Kolb an Krenn, "Sie diskriminieren sich selbst, das Bischofsamt, die Österreichische Bischofskonferenz und die katholische Kirche. Das Maß ist voll. Rom muß handeln. Steigen Sie herab vom hohen Roß, von ihrem bischöflichen Thron und treten Sie zurück!"
"Schwere theologische Defizite"
Kolb wirft in dem Schreiben Krenn auch "schwere theologische Defizite" vor: So gebe es u.a. nicht mehr die katholische Theologie schlechthin, sonderen mehrere legitime Interpretationen. Krenn habe auch wesentliche Positionen des II. Vaticanums nicht wirklich rezipiert - wie etwa das Prinzip der Kollegialität, des Dialogs und der Toleranz.
Niemand, so Kolb in dem auch an Kardinal Schönborn, Bischof Weber und den Nuntius, Erzbischof Donato Squicciarini gerichteten Schreiben, "will über Dogmen abstimmen." Darüberhinaus, so der Uni-Professor an Krenn, "schädigen Sie auch Rom, ja sogar den Papst, in dessen Diensten Sie sich wähnen." Aus diesem Grund sei ein Rücktritt überfällig.
Auch die Bundesvertretung der Theologiestudierenden Österreichs hat in einem Brief an den Nuntius den Papst um eine Änderung in der Leitung der Diözese St. Pölten gebeten. Durch das Verhanlten Krenns seien der Prozeß der Erneuerung der Kirche und ihre Glaubwüdigkeit gefährdet, heißt es in dem Schrieben.
Evangelischer Bischof bedauert "zerstörerischen Konflikt"
Der evangelische Bischof Herwig Sturm bedauert den "zerstörerischen und völlig überflüssigen Konflikt" innerhalb der katholischen Kirche. Vom Streit um den St. Pöltner Bischof Kurt Krenn sei auch die evangelische Kirche betroffen, denn: "Der Großteil der Bevölkerung differenziert nicht", sagte Sturm am Mittwoch in einer Pressekonferenz: "Die unangenehmen Geschichten betreffen immer alle Kirchen."
Für Sturm macht der Konflikt um Krenn einmal mehr deutlich, wie sehr eine "künstliche Autorität" in Gefahr sei, wenn sie nicht "von unten aufgebaut ist". Sturm: "Wenn in der evangelischen Kirche der Widerstand gegen einen Amtsträger dermaßen groß wäre, dann wäre die Situation längst bereinigt oder der Amtsträger nicht mehr im Amt." Der Konflikt habe nichts mit der "Wahrheit des Evangeliums" zu tun, sondern sei eine Frage der Personalpolitik.
FPÖ-Poglitsch gegen "Hatz auf Krenn"
Der burgenländische FPÖ-Labg. Reinhard Poglitsch sprach sich am Mittwoch im Pressedienst seiner Partei "gegen die Hatz auf Bischof Krenn" aus. Bischof Krenn lebe und handle nach den Zeilen des Neuen Testaments, stellte Poglitsch fest, nach eigenen Angaben praktizierender Christ und Kommunionhelfer.
Der Brief des Forums Kirchenzukunft an Rom, man möge Bischof Krenn abberufen, gipfelt nach Ansicht des freiheitlichen Politikers in Geschmacklosigkeit.
Falsches Geburtstdatum Christi
Auch wenn sich zahlreiche Legenden um den populärsten christlichen Feier- und Brauchtumstermin ranken, eines ist sicher: Der Ausgangspunkt der weltweiten Erfolgsstory von Weihnachten, die Geburt von Jesus Christus, passierte weder am Vorabend des 25. Dezember, noch im Jahre Null, wie uns der Kalender suggeriert. Diese und andere Weihnachtsgeschichten hat ein Volkskundler- und Historikerteam zusammengetragen und sie für einen zweiteiligen Vortrag im Grazer Stadtmuseum aufbereitet.
Zieht man die Bibel zu Rate, so kommt man auf unterschiedliche Geburtstermine, die zwischen einige Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung und sechs bis sieben Jahre danach schwanken. Beruft man sich auf auffällige Planenten-Konstellationen, dann kommen die Jahre 2 oder 1 v.Chr. in Frage.
Das Fest "sol invictus"
Daß man das Weihnachtsfest auf den 25. Dezember fallen ließ, dürfte auf das im 3. Jahrhundert von den Römern eingeführte (heidnische) Fest "sol invictus" ("die unbesiegbare Sonne") zurückgehen. Sicher hat der Termin mit der Wintersonnenwende zu tun, die zwar schon am 21. Dezember stattfindet, aber erst am 25. Dezember, wenn auch nur marginal, bemerkbar ist. Wie die Überlieferung berichtet, fand das erste christliche Weihnachtsfest am 25. Dezember 336 in Rom statt.
Leichter als diese Herkunftsdeutungen ist die Frage, warum das Hochfest der Geburt Christi nicht am 25., sondern bereits am Vorabend, also am 24.12., gefeiert wird. Hier überzeugt der Verweis auf ein anderes Kalenderdenken alter Hochkulturen, etwa der griechischen, in der der Tag nicht - wie heute üblich - von Mitternacht bis Mitternacht, sondern von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang gezählt wurde. Auf diese Weise wurde der Vorabend bereits zum folgenden Tag gerechnet.
"Geweihte Nacht"
Der Ausdruck "Weihnachten" leitet sich übrigens vom althochdeutschen Wort "wih", das soviel bedeutet wie "heilig" oder "geweiht". Wörtlich übersetzt heißt also Weihnachten nichts anderes als "Heilige Nacht".
Auch wenn sich Weihnachten als Fest der Freude und des Schenkens weltweit durchgesetzt hat, wird es in den Kulturen rund um den Globus recht unterschiedlich begangen. Ein kleiner Rundblick, zusammengestellt von Gerhard Dienes, Direktor des Grazer Stadtmuseums, und Maria Brunner.
Von Gänsebraten und Punsch
In Dänemark bilden Reisbrei und Gänsebraten, aber auch Fische das traditionelle Festmahl. In Schweden wird der "Julglögg", ein spezieller Glühwein, serviert, in Norwegen Rotweinpunsch. Gäste, die im hohen Norden einer Weihnachtsfeier beiwohnen wollen, müssen einen starken Magen mitbringen: Nach mit Zuckerglasur überzogenem, gekochtem Schinken, der mit Burgundersoße und Kastanien serviert wird, folgt "Lutfisk", ein mit Sodlauge und Kalk präparierter Kabeljau.
In allen skandinavischen Ländern ist es üblich, in Vor- oder Nachspeise eine Mandel zu verstecken, die dem glücklichen Finder ein besonderes Geschenk einbringt. Etwas übermütig mutet der schwedische Brauch an, den Christbaum am 13. Jänner - nach der "Plünderung" - kurzerhand aus dem Fenster zu werfen.
Der Dezember - eine einzige große Party
In Großbritannien wird der Weihnachtsmonat als einzige große Party zelebriert. Christmas heißt, sich zu vergnügen und ausgiebig nachbarschaftliche Freundschaften zu pflegen. Den Höhepunkt bildet der 25. Dezember, das traditionelle Festmahl ist der "turkey", der Truthahn. Den Heiligen Abend kennt man nicht.
Keine Spur von Besinnlichkeit gibt es auch in Frankreich, denn zu Weihnachten ist "die Hölle los". Austern und Champagner, von dem zwischen Weihnachten und Neujahr rund ein Drittel des Jahreskonsums getrunken wird, eröffnen den kulinarischen Reigen, zu dem auch eine "boudin blanc", eine mit Trüffeln oder Mandelsplittern gespickte Weißwurst, und eine Art Buttercremetorte ("buche de noel") gehören.
US-Erfindung Einkaufsrausch
Einen ganz besonderen Status hat das Weihnachtsfest jenseits des Großen Teiches: Ursprünglich war es von europäischen Einflüssen, insbesondere durch deutsche Einwanderer, geprägt, dann traten die kommerziellen Aspekte in den Vordergrund. Vor allem der Einkaufsrausch scheint eine amerikanische Erfindung zu sein. Als echter Feiertag gilt nur der 25. Dezember.
Kerzen an Pinien und Kakteen
In Mexiko wird der Weihnachtsabend als "Geburtstagsfest" ausgelassen und lautstark gefeiert, Geschenke gibt es erst am 6. Jänner, dem Epiphanienfest. Weihnachten ohne Schnee feiert man in Bolivien mit Tanz, Empanadas (gefüllte Teigtaschen) und Maisbier, in Brasilien werden bei tropischen Temperaturen Kerzen an Pinien und Kakteen oder an Weihnachtsbäumen aus Pappmache befestigt. Das Jesuskind liegt nicht in der Krippe, sondern in der Hängematte.
In Afrika ist in der Festgestaltung noch das Wirken der Missonare erkennbar, aber auch Elemente eigener alter Feierkultur sind erhalten geblieben. Mit Volksgesängen und rhythmischen Tänzen wird im Hochsommer Weihnachten gefeiert, Herbergssuche und Krippenspiel werden dramatisiert nachgespielt, wobei bei den Massai mitunter auch Neugeborene die Rolle des Jesuskindes übernehmen.
In Singapur und Australien kommt der Weihnachtsmann stilecht mit dem Surfbrett - ansonsten regiert die amerikanische Art der Fest- und Schenkkultur. Obwohl sich nur 1,5 Prozent der Japaner zum christlichen Glauben gekennen, erfreut sich das Fest auch in Nippon immer größerer Beliebtheit. Partys werden veranstaltet, man verkleidet sich als Santa Claus oder Engel mit Heiligenschein und Flügeln, die Ausrüstung "made in China" kauft man im Supermarkt.