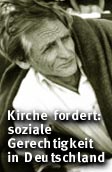


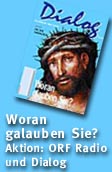

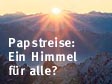
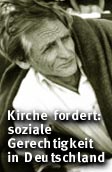 |
  |
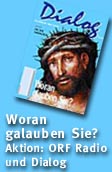 |
|
 |
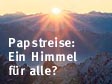 |
||
News vom 7. 11. 99
"Woran ich glaube" ist eine gemeinsame Aktion von "Dialog" und der ORF-Hörfunk-Abteilung Religion. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Welchen Sinn hat mein Leben? – Das sind Fragen, die sich jeder Mensch immer wieder stellt. Der "Dialog" startet eine Aktion, die zum Dialog zwischen Menschen einlädt. Hörer und Leser sind eingeladen zu schreiben woran sie glauben, was sie glauben läßt. Erzählungen von "Glaubensgeschichten" oder Beschreibungen von "Glaubenszeichen" die auf dem Lebensweg begleiten oder begleitet haben.
Richten Sie Ihre Zuschriften an "Dialog" Kennwort "Woran ich glaube", 1011 Wien, Stephansplatz 4 oder per E-mail an: religion.hf@orf.at
Vatikan bekräftigt Ausstieg der Kirche aus Schwangerenberatung
Der Ausstieg der katholischen Kirche Deutschlands aus der gesetzlichen Schwangerschaftskonfliktberatung scheint unausweichlich. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete, geht das aus einem Schreiben hervor, das Kardinal-Staatssekretär Angelo Sodano an die mutmaßlich zwölf Diözesanbischöfe gerichtet hat, die sich im Oktober nochmals schriftlich an Papst Johannes Paul II. gewandt hatten. Weder die Deutsche Bischofskonferenz noch einzelne Diözesanleitungen wollten sich zu dem Zeitungsbericht äußern; aus der Umgebung eines betroffenen Bischofs wurde das Vorliegen des Schreibens aber bestätigt. Laut FAZ werden alle Bedenken dieser Bischöfe gegen das Ende der kirchlichen Konfliktberatung unter Verweis auf den bindenden Charakter der päpstlichen Weisungen vom 18. September für unmaßgeblich erklärt. Damals hatten die Kardinäle Sodano und Ratzinger den deutschen Bischöfen mitgeteilt, dass nach dem Willen des Papstes eine in katholischen Beratungsstellen ausgestellte Beratungsbescheinigung nicht mehr geeignet sein dürfe, den "Zugang zur Abtreibung nach StGB Paragraf 218 a (1) zu eröffnen". Daraufhin hatten Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt von Paderborn und Bischof Anton Schlembach von Speyer angekündigt, in den Beratungsstellen ihrer Diözesen vom 1. Jänner 2000 an keine Bescheinigungen mehr auszustellen. Die deutschen Bischöfe reisen ab Montag zu den alle fünf Jahre anstehenden "Ad-Limina"-Besuchen in den Vatikan. Dabei wollen einzelne Bischöfe dem Papst persönlich ihre Bedenken wegen eines Ausstiegs vortragen.
Jeder Bischof kann zwischen 15 und 30 Minuten allein mit dem 79-jährigen Oberhaupt der katholischen Kirche sprechen. Insider bezweifeln allerdings, dass sich am Nein des Papstes zur bisherigen Praxis etwas ändert. Viele deutsche Oberhirten stehen vor der schwersten Entscheidung ihrer Amtszeit.
Mehrere Bischöfe wollen bei dem turnusmäßigen Ad-Limina-Besuch von diesem Montag bis zum 21. November versuchen, den Papst doch noch umzustimmen. Erst nach den Gesprächen im Vatikan wollen sie entscheiden, wie die Konfliktberatung in ihren Diözesen in Zukunft geregelt werden soll. Bischof Hubert Luthe (Essen) sprach von der "schwersten Gewissensentscheidung" in seiner Amtszeit. Ähnlich äußerte sich auch sein Amtskollege Anton Schlembach in Speyer. Insider warnen vor einer Kirchenspaltung, von Rücktritten und Auflehnung gegen den Papst ist die Rede. Der Vatikan will, dass in rund 270 katholischen Beratungsstellen in die für eine straffreie Abtreibung vorgeschriebenen Beratungsscheine künftig nicht mehr ausgestellt werden. Die deutsche Bischofskonferenz hatte sich im September dem Willen des Papstes gebeugt und den Ausstieg aus dem staatlichen Beratungssystem beschlossen. Dafür bleibt den Oberhirten eine Übergangsfrist bis Ende kommenden Jahres. Nach Fulda sollen bereits vom Jänner 2000 an auch in den Bistümern Paderborn und Speyer keine Beratungsscheine mehr ausgestellt werden. "Wir werden die Kinder im Stich lassen, weil wir die Frauen nicht mehr erreichen", warnt Walter Bayerlein, Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Von einem "Akt unterlassener Hilfeleistung" spricht die katholische Reformbewegung "Wir sind Kirche". In dem Konflikt steht der konservative Flügel um Erzbischof Johannes Dyba (Fulda) und Kölns Kardinal Joachim Meisner der Mehrheit hinter dem alten und neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Lehmann (Mainz), gegenüber. Bereits im September 1993 hatte Dyba als Einziger die Ausgabe von Beratungsscheinen in seinem Bistum untersagt. Die Scheine sind für ihn "Tötungslizenzen". Auf Initiative der "grauen Eminenz" Meisner in Rom kippte die zuletzt gefundene Kompromissformel. Als mögliche "Mitläufer" der beiden Hardliner gelten in Kirchenkreisen die eher konservativen Erzbischöfe von Bamberg und Paderborn, Karl Braun und Johannes Joachim Degenhardt sowie der Bischof in Eichstätt, Walter Mixa. "Mich erschreckt die Polarisierung", sagt der Würzburger Bischof Paul-Werner Scheele. "Wie eine Seite über die andere spricht, das ähnelt mitunter Kriegsberichten."
"Ich werde ganz konkret die Frage stellen, wer die Verantwortung übernimmt für all die Kinder, die durch unser Fehlen in der staatlichen Beratung nicht mehr das Licht der Welt erblicken", sagt der Erfurter Bischof Joachim Wanke. Ähnliche Bedenken hat sein Regensburger Amtskollege Manfred Müller. Nachweislich entscheiden sich mindestens 5.000 werdende Mütter pro Jahr nach einer katholischen Konfliktberatung für ihr Kind.
"Wir kämpfen weiter", kündigte Lehmann an. Aber er glaube nicht mehr an einen Kompromiss im Streit um die Schwangerenberatung." (APA, KAP, FAZ)
Indien - ein Himmel für alle Religionen?
Drei Mal griff der Papst in den Korb mit roten Blüten und streute sie nachdenklich auf die Gedenkstätte des indischen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi. "Keine Kultur kann überleben, wenn sie versucht, exklusiv zu sein", schrieb er anschließend in das Gästebuch des Raj Ghat, des Mausoleums im Zentrum der indischen Hauptstadt New Delhi. Die Zeremonie an der Gedenkstätte für den 1948 von einem fanatischen Hindu ermordeten Gandhi war erster Höhepunkt des Papstbesuches am Samstag in Indien. Sichtlich bewegt erwies der Papst dem Mann seine Referenz, der mit gewaltfreien Mitteln Unabhängigkeit und Gerechtigkeit durchsetzte. Gandhi hatte sich gegen jene Übel gewandt, die auch Johannes Paul II. bekämpft: dass Politik nicht prinzipienlos sein darf, dass Moral auch in die Geschäftswelt gehört und dass es Wissenschaft ohne Menschlichkeit nicht geben darf. Nach dem kühlen Empfang für den Papst am Freitagabend - die Regierung war am Flughafen nur durch einen Staatssekretär vertreten - war der offizielle Empfang am Samstagmorgen freundlicher. Nach der Polemik faschistoider Hindugruppierungen strichen sowohl Staatspräsident Kocheril Raman Narayanan als anschließend auch Ministerpräsident Atal Bihari Vajpayee die Toleranz ihres Landes heraus. In seinem Land gebe es Religionsfreiheit, man glaube an das Zusammenleben der Menschen, betonte der Präsident bei der Unterredung, die Vatikansprecher Joaquin Navarro-Valls als "sehr herzlich" bezeichnete. Auch der Ministerpräsident beschwor gegenüber dem Papst das friedliche Zusammenleben in seinem Land. "Die beste Botschaft für das dritte Jahrtausend muss das Zusammenleben sein", sagte er.
Vizepräsident Krishan Kant erklärte: "Indien muss ein Himmel für alle Religionen bleiben; denn wir alle glauben, dass Religion und Kultur Synonyme sind, dass Religion und Nation aber nicht sinnverwandt sind". Eine unmissverständliche Absage an militante Hindus, die in Indien die Trennung von Religion und Staat abschaffen und das Land zu einem hinduistischen Staat machen wollen, und die im gleichen Atemzug den religiösen Minderheiten das Leben schwer machen. In der Tat häuften sich in den letzten beiden Jahren die Ausschreitungen radikaler Hindus gegen Christen: Priester und Gläubige wurden verprügelt, einige getötet, Kirchen wurden verwüstet oder angezündet, Ordensfrauen vergewaltigt. Die bei den Parlamentswahlen soeben bestätigte Koalition um die rechtsorientierte "Bharata Janata Party" (BJP) habe bislang gegen Scharfmacher und Täter zu wenig getan, beklagen Kirchenleute in New Delhi. Trotz der freundlichen offiziellen Begrüßung - auffallend lange und herzlich unterhielt sich der Papst beim Empfang im Präsidentenpalais auch mit Oppositionspolitikerin Sonja Gandhi - nimmt die Bevölkerung New Delhis vom Papst kaum Notiz. Es gibt keine Girlanden und keine jubelnden Menschenmassen, die das Kirchenoberhaupt sonst bei seinen Auslandsreisen begrüßen. Zudem verdrängt der Wirbelsturm im Bundesstaat Orissa die Papstvisite in den Medien auf die hinteren Plätze. Allerdings geht es bei der Papstreise nur in zweiter Linie um Indien.
Anlass ist der feierliche Abschluss der Sondersynode zu Asien, deren Arbeitsteil vor eineinhalb Jahren in Rom stattgefunden hatte. Mit dem Schlussdokument dieser Bischofssynode geht es zugleich um den künftigen Kurs für die Kirche in Asien. Der Papst will die Kirche weiterhin zur Missionsarbeit verpflichten, zugleich aber auch zum Dialog mit den anderen Religionen anhalten. Das setzt aber, davon ist die Kirche überzeugt, Toleranz und Religionsfreiheit voraus. Und die ist nach Ansicht der Vatikanspitze bis heute in manchen Teilen Asiens nicht realisiert.
Gerade drei Prozent der Bevölkerung Asiens sind katholisch. Bei dieser Minderheitensituation hatte das Treffen des Papstes mit Vertretern der anderen Religionen in New Delhi mehr als nur symbolische Bedeutung. Denn beim neuen Anlauf zum interreligiösen Dialog, den der Papst bei seiner dreitägigen Indienreise ankündigte, sollen die großen alten Religionen verstärkt Partner der Kirchen werden. Vor Vertretern anderer christlicher Kirchen, aber auch in Anwesenheit von Hindus, Muslimen, Sikhs, Buddhisten, Jains, Parsen, Juden und Bahai, rief Johannes Paul II. zum Dialog mit der katholischen Kirche auf. Angesichts der großen Probleme und Herausforderungen müssten die Religionen mehr gemeinsame Verantwortung für die Zukunft der Menschheit übernehmen. Ausdrücklich warnte der Papst davor, Religion als Vorwand für Konflikte und Gewalt zu nehmen. Religion gehöre mit Frieden, Harmonie und Respekt zusammen. "Religionskrieg" sei ein Widerspruch in sich, warnte der Papst. Eindringlich versuchte Johannes Paul II., Berührungsängste und Furcht vor einem religionsübergreifenden Dialog abzubauen. Mit dem Gesprächs-Angebot wollten die Katholiken niemandem ihre Meinung aufzwingen, aber auch nicht aus falschem Entgegenkommen die eigene Position aufgeben. Zugleich bezeichnete er Religionsfreiheit als unverzichtbare Voraussetzung für jedes gesellschaftliche Leben. "Kein Staat und keine Gruppe hat das Recht, direkt oder indirekt eine religiöse Überzeugung zu kontrollieren", zu bestimmen oder zu verbieten. Und demzufolge hat auch jeder das Recht, seine Religion zu wechseln. Das eigene Gewissen sei hier oberste Norm. Es war eine bunte Feier mit vielen Friedenswünschen und freundlichen Worten an den Papst. Zu Beginn wurden nach indischem Brauch Kerzen entzündet. Eine Hindusängerin trug ein Friedenslied vor. Nacheinander sangen ein Muslimvertreter und ein Rabbi Gebetstexte. Ein Hindupriester begrüßte "Shri Pope John Paul II." als "Herrscher der Herzen von Millionen Christen". Der Hinduismus trete für Wahrheit, Liebe und gutes Verhalten ein; und in diesem Geist begrüße er den Staatsgast: "Wir sind Ihnen äußerst dankbar für Ihre Botschaft der Liebe und Ihren Besuch." Der Papst habe seine Mission, "eine spirituelle Einheit in der Welt zu etablieren, und wir sind dabei mit Ihnen", so der Hindupriester: "Akzeptieren Sie die Offenheit unserer Religion und unserer Liebe". Der Rabbi verurteilte in seinem Statement Gewalt und vor allem Rassismus und Antisemitismus. Angesichts unmenschlicher Bedingungen in der Welt sollten die Religionen gemeinsam vorgehen und sich zum neuen Millennium um Frieden und Harmonie für alle bemühen. Und der Muslimvertreter forderte eine Einheit der Religionen, um die Spaltung in der Welt zu überwinden und zum Frieden zu kommen. Während die Veranstaltung öffentlich einen sehr harmonischen Eindruck machte, kam es hinter den Kulissen zu Spannungen zwischen einigen Vertretern der verschiedenen Religionen. Neben grundsätzlichen Überlegungen zum interreligiösen Dialog ging der Papst auch auf die konkrete Situation in Indien ein, wo die Katholiken in letzter Zeit zunehmend der Gewalt militanter Hindus ausgesetzt sind. Johannes Paul II. forderte Toleranz, Dialog und Zusammenarbeit. Den Vorwurf der Hindus, katholische Priester betrieben Zwangsbekehrung, wies der Papst zurück. (KAP, Johannes Schidelko)
Papst für Ausbreitung des Christentums in Asien
Papst Johannes Paul II. hofft auf eine neuerliche Ausbreitung des Christentums in Asien im kommenden Jahrtausend. Bei einem feierlichen Gottesdienst im Nehru-Stadion von New Delhi erinnerte der Papst am Sonntag morgen daran, dass Jesus auf asiatischem Boden geboren wurde. So wie die Kirche in den ersten beiden Jahrtausenden erst in Europa und dann in Amerika und Afrika Wurzeln geschlagen habe, solle im dritten Jahrtausend der christliche Glaube auch in Asien eine reiche Ernte bringen. Zugleich appellierte der Papst in seiner Predigt an die Bekenner anderer Religionen, mit den Christen gemeinsam den Weg des Friedens und des gegenseitigen Respekts zu beschreiten. Er träume, dass das nächste Jahrhundert ein Zeitalter des Dialogs, des Verstehens und der Solidarität unter den Anhängern aller Religionen werde, sagte der Papst. Die Lehre, dass der Mensch dazu berufen sei, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben, sei dem Christentum und den Weisheitslehren anderer Religionen gemeinsam. Der Papst betonte, die Welt könne nur durch den gemeinsamen Einsatz aller Menschen guten Willens verändert werden. Die Katholiken in Asien forderte Johannes Paul II. auf, überzeugende Vorbilder für andere zu sein. Sie sollten in ihrem Leben die Botschaft verkörpern, die sie verkündeten. Neben den Priestern und Ordensleuten komme insbesondere den Laien dabei eine besondere Aufgabe zu. In einer Welt krasser Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen sollten sie das menschliche Leben und seine Würde verteidigen und die christlichen Werte in alle Ebenen der Gesellschaft einbringen. Offizieller Anlass der Eucharistiefeier war der feierliche Abschluss der Asien-Synode, die im April 1998 im Vatikan stattgefunden hatte. Zu dem Gottesdienst waren rund 300 Bischöfe aus allen Teilen Asiens erschienen.
Zum Abschluss der Messe erinnerte Johannes Paul II. auch an die vor zwei Jahr verstorbene Ordensgründerin und Friedensnobelpreisträgerin Mutter Teresa. "Ich bitte die ganze Kirche, ihr Zeugnis der Liebe im Sinne des Evangeliums, insbesondere gegenüber den Ärmsten der Armen, niemals zu vergessen", sagte der Papst. Mutter Teresa werde stets mit dem indischen Volk sein. Neben dem Altar stand ein Bild der Gründerin des Ordens der "Missionarinnen der Nächstenliebe". Gemeinsam mit mehreren Schwester des Ordens nahm auch die Nachfolgerin Mutter Teresas als Generaloberin, Schwester Nirmala, an der Feier teil.
Auf dem Flug von New Delhi am Montag nach Tiflis wird der Papst die "fliegende
Noch am Montag wird der Papst mit dem georgischen Katholikos-Patriarchen Elias II. und den Mitgliedern des Heiligen Synods der georgisch-orthodoxen Kirche zusammentreffen. Am Abend ist ein Besuch der Patriarchalkathedrale in Mzcheta vorgesehen. Am Dienstag wird der Papst u.a. das neue Caritas-Zentrum in Tiflis segnen und mit dem georgischen Staatspräsidenten Edward Shewardnadze zusammentreffen. Auch eine Messfeier auf einem zentralen Platz der georgischen Hauptstadt ist vorgesehen. Am Dienstagabend wird Johannes Paul II. in Rom zurückerwartet. Dem Georgien-Besuch wird besondere Bedeutung eingeräumt, weil es sich - nach der Rumänien-Visite - um den zweiten Besuch des Papstes in einem Land orthodoxer Tradition handelt. Die ökumenische Haltung der georgisch-orthodoxen Kirche ist umstritten. Der Katholikos-Patriarch ist zwar ein überzeugter Befürworter der ökumenischen Bewegung, es gibt in der georgischen Kirche aber einflussreiche Strömungen, die jeder Kontaktnahme mit den "irrgläubigen" Kirchen des Westens skeptisch gegenüberstehen. Die georgisch-orthodoxe Kirche musste daher auch ihre Mitgliedschaft im Weltkirchenrat sistieren. (APA, KAP)
Katholischer Dialog mit Orthodoxen und Moslems
Der Generalsekretär des Internationalen Rates der Christen und Juden (ICCJ), Friedhelm Pieper, hat von der Katholischen Kirche ein klares Bekenntnis zur Mitschuld am Antisemitismus verlangt.
Der Vatikan habe sich bis heute nicht dazu bekannt, dass die Katholische Kirche im internationalen Antijudaismus über Jahrhunderte eine Rolle gespielt habe, sagte Pieper am Sonntag bei einer Feier zum 50-jährigen Bestehen des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (CJZ) in Bad Nauheim (Hessen). Trotz aller Erfolge dieser Gesellschaften bestehe ein wachsender Bedarf an ihrer Arbeit. Zu den Herausforderungen der Christlich-Jüdischen Gesellschaften gehörten neben dieser Auseinandersetzung auch die Aufnahme von Gesprächen mit der orthodoxen Kirche und eine verstärkte Kontaktaufnahme mit Moslems. Der Deutsche Koordinierungsrat (DKR) der CJZ-Gesellschaften wurde 1949 in Bad Nauheim gegründet und hat auch heute noch dort seinen Sitz. Er vertritt die 79 deutschen CJZ-Gesellschaften mit ihren rund 20.000 Mitgliedern auf nationaler und internationaler Ebene und hat die Verständigung und Zusammenarbeit zwischen Christen und Juden zum Ziel. (DPA, APA)
Nazareth: Moschee wird neben Verkündigugskirche gebaut
Die islamische Bewegung in Nazareth, der Heimatstadt Jesu in Nordisrael, hat am Sonntag begonnen, ihr riesiges Protestzelt neben der Verkündigungskirche abzubrechen. Die Islamisten hatten das Zelt in der arabischen Kernstadt Nazareths vor fast zwei Jahren aufgestellt, um ihre Forderung nach dem Bau einer Moschee auf dem Platz zu unterstreichen. Die israelische Regierung und der christliche Bürgermeister hatten der Forderung nach massiven Zusammenstößen zwischen moslemischen und christlichen Arabern während der Oster-Feiertage zugestimmt.
Aus Protest gegen den Bau der Moschee bleiben die Kirchen in Israel am 22. und 23. November geschlossen. Die Führer der christlichen Gemeinden in Israel sehen den Moschee-Bau als Zugeständnis an Fundamentalisten und "Preis für Gewalt" an. Bereits nach den Oster-Unruhen hatten die Kirchen in Nazareth ihre Türen für mehrere Tage geschlossen. Vor dem Weihnachtsfest und den Silvesterfeiern 2000 ist die Stimmung in Nazareth angespannt. Mehr als 60 Prozent der arabischen Bevölkerung der Stadt sind Moslems. Das umstrittene Gelände, auf dem die Stadt Nazareth ursprünglich nur einen Veranstaltungspark für christliche Pilger in der Stadt errichten wollte, gehört dem Staat. Dort, wo heute die Kirche steht, soll der Engel Gabriel der Jungfrau Maria die Geburt Jesu angekündigt haben. Mit dem Bau der Moschee soll nicht vor dem Jahr 2000 begonnen werden. Für eine Gestaltung des Parks bleibt bis zu den Festtagen nicht mehr viel Zeit. (KAP)
Evangleische Kirche fordert: Mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat von der Mitte-Links-Regierung mehr soziale Gerechtigkeit in ihrer Politik verlangt. Der EKD-Ratsvorsitzende, Manfred Kock, kritisierte am Sonntag in Leipzig (Sachsen), dass im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit die versprochenen Impulse bisher ausgeblieben seien.
Er forderte zum Auftakt der Jahrestagung der EKD-Synode die rot- grüne Koalition zu einer sozial ausgewogenen Sparpolitik auf. Bei aller Akzeptanz von notwendigen Sparmaßnahmen dürfe es nicht sein, dass Arbeitslose und Menschen an der unteren Einkommensskala besonders betroffen seien. Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte zuvor vor den 120 Synodalen für die Sparpolitik seiner Regierung geworben und die Furcht der Kirchen vor wachsender sozialer Ungerechtigkeit als unbegründet bezeichnet. Sparprogramm und Steuerreform würden nicht einseitig nur die Schwächeren der Gesellschaft belasten, sagte der Sozialdemokrat. Schröder unterstrich die Partnerschaft von Staat und Kirche. "Ich bin dafür, an der besonderen Form der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen staatlichen Institutionen und der Kirche festzuhalten." Es seien die Kirchen, die den Menschen in der schwieriger werdenden wirtschaftlichen Situation Orientierungshilfen anböten. "Die Politik wäre damit überfordert", sagte Schröder. Hauptthemen der sechstägigen EKD-Synode in Leipzig sind die Missionsarbeit, der Kirchenhaushalt 2000 und weitere Sparmaßnahmen.
Bundespräsident Johannes Rau ist am 9. November Gast des Kirchenparlaments, das an diesem Tag besonders des Herbstes 1989 gedenken will. Das Kirchenparlament vertritt etwa 27 Millionen Protestanten aus 24 Mitgliedskirchen in Deutschland. (DPA)
Kardinal Franz König erhält Wartburgpreis
Der Wartburgpreis 1999 geht an den Präsidenten der internationalen katholischen Friedensbewegung, der Wiener Alterzbischof Kardinal Franz König. Als einer der einflussreichsten Vordenker der katholischen Kirche sei der Österreicher stets um ein Klima der Toleranz zwischen den Religionen bemüht, würdigte die Wartburg-Stiftung den Kardinal am Samstag in Eisenach (Thüringen).
Der mit 10.000 DM (70.000 S) dotierte Preis soll ihm am 17. November im Festsaal der Wartburg überreicht werden. Die Laudatio hält der Preisträger des Jahres 1997, Paul Oestreicher. Die 1921 gegründete Wartburg-Stiftung vergibt ihre Auszeichnung für herausragende Verdienste um die deutsche und europäische Einigung. Der Preis wird in diesem Jahr zum achten Mal vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören die früheren Außenminister Frankreichs, Polens und Deutschlands, Roland Dumas, Krysztof Skubiszewski und Hans-Dietrich Genscher sowie der ehemalige deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker und der französische Politikwissenschaftler Alfred Grosser.
Bischof Stecher warnt vor "Spiel mit Hassobjekten"
Mit einer Warnung vor dem immer wiederkehrenden "Spiel mit Hassobjekten, bis in das Österreich unserer Tage" hat sich der Innsbrucker Altbischof Reinhold Stecher zu Wort gemeldet. "Alle Tyrannen, Populisten und Volksverführer haben ein Geschäft mit Erfolg betrieben: sie schufen und schaffen Hassobjekte", warnte der Bischof im Rahmen eines Gastvortrags am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung in Wien. Mit dem Schaffen von Hassobjekten gäben die Volksverführer ihren Gefolgsleuten und Mitläufern das - so Stecher - "beinahe heldische Gefühl, Kämpfer gegen das Böse zu sein". Auf diese Weise könne sich der Mensch "moralisch aufplustern" und die eigenen Minderwertigkeitsgefühle verdrängen oder wegstecken. Stecher verwies auf ein Sprichwort aus Westafrika: "Das Böse ist ein Hügel - jeder steht auf seinem eigenen und zeigt auf einen anderen". So sei das Spiel mit Hassobjekten leider "immer wieder erfolgreich". Bischof Stecher forderte verstärkte Maßnahmen im Bildungsbereich, weil die Überwindung von Vorurteilen und Aggressionen immer auch eine Frage der Bildung sei. Stecher: "Alle Formen eingefleischter Vorurteile und Fanatismen sind bis zum heutigen Tag nicht nur moralisch bedenklich, sie sind auch ein Stück Dummheit." Toleranz dagegen brauche Horizont-Erweiterung, kritisches und selbstkritisches Denken, das Wissen und Verstehen der Überzeugung des anderen sowie eine seriöse Begründung des eigenen Standpunkts. Der Innsbrucker Alt-Bischof rief in seinem Vortrag auf, die "Brücke der Begegnung" zwischen Juden und Christen über "den tiefen Abgrund der Geschichte" weiterzubauen. Für ihn sei die Begegnung mit Juden stets etwas "Eindrucksvolles", weil sie auf jüdischer Seite auf Grund vieler bitterer Erfahrungen in der Geschichte "wirklich menschliche Größe" brauche. Es sei nun einmal die jüdische Seite, die bei diesem Dialog die "Belastungen" durch die unrühmliche Geschichte von Kirche und Synagoge zu verarbeiten habe und Grund hätte, den Brückenschlag abzulehnen. "Darum sind diese menschlichen Begegnungen für mich alles andere als eine Selbstverständlichkeit", sagte Stecher: "Und dieser Abend ist ein Grund, dafür einmal öffentlich zu danken." (KAP)
Sendung Orientierung: 30 Jahre-Jubiläumsevent
Prominenz aus Kirche und Medien feierte am 27. Oktober 1999, im Palais
Liechtenstein 30 Jahre TV-Religionsmagazin "Orientierung".
Heute ist das ORF-Religionsmagazin das älteste TV-Informationsmagazin des ORF. Seit dem
27. Jänner 1969 wurde "Orientierung" mehr als 1.200mal ausgestrahlt.
ORF-Generalintendant Gerhard Weis hatte zu diesem Jubiläumsevent, das von Doris Appel,
Präsentatorin von "Orientierung", moderiert wurde, eingeladen und freute sich
"so viele Vertreter der Religionen und so viele Freunde der Sendung begrüßen zu
können."
 |
 |
 |
 |
| Bischof Heiz, Altkatholische Kirche | General Intendant Gerhard Weis | Ex-TV Direktor Helmut Zilk | Hauptabteilungsleiter Religion Gerhard Klein |
Gekommen waren hohe Würdenträger fast aller Religions- und Bekenntnisgemeinschaften, u. a. Kardinal Franz König, Kardinal Christoph Schönborn, Oberrabiner Paul Chaim Eisenberg, der altkatholische Bischof Bernhard Heitz, Metropolit Michael Staikos, Bischof Herwig Sturm sowie Vertreter der Methodisten, Buddhisten und Vertreter weiterer Religions- und Bekenntnisgemeinschaften. Mit dabei waren auch ORF-Informationsintendant Hannes Leopoldseder, Altbürgermeister Helmut Zilk, Kaplan August Paterno u. v. m.
 |
 |
 |
 |
| Regiebesprechung Marcus Marschalek, Doris Appel | Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg | gefeiert wurde im Palais Lichtenstein | August Paterno im Kreise von Journalisten |
Weis betonte auch die Einmaligkeit dieses Jubiläums, da "in unserer schnellebigen Zeit wenigen Fernsehformaten ein derart langes Leben beschieden ist. Sendungen, die allzusehr auf den Zeitgeist setzen, werden vom Zeitgeist eingeholt und schließlich überholt. Im Gegensatz dazu setzt "Orientierung" nicht auf Zeitgeistiges, sondern auf Geistiges."
 |
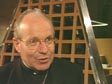 |
 |
 |
| Swing und Soul kam von den "Rounder Girls" | Erzbischof Schönborn | Ex-General Vikar Helmut Schüller | Sendungsverantwortlicher Christian Rathner |
Gerhard Klein, Leiter der ORF-TV-Hauptabteilung Religion, erinnerte in seiner Rede an
bereits verstorbene "Väter der Orientierung", Anton Fellner und Eduard Ploier,
und bedankte sich auch bei den weiteren "Orientierung"-Protagonisten Michael
Weinmann und Herbert Weissenberger, bei Ernst Niesner, Hubert Feichtlbauer und Peter
Pawlowsky, die ebenfalls die Anfänge von "Orientierung" prägten. Ein kurzer
Film zeigte 30 TV-Jahre "Orientierung" und verdeutlichte, daß das
Redaktions-Team sich bis heute nicht scheut, "heiße Eisen" wie Zölibat oder
Kirchenbeitrag aufzugreifen. Die Historikerin Dr. Erika Weinzierl erinnerte sich in ihrer
Festrede an "30 Jahre Orientierung", die Teil von 30 Jahren bewegender
Zeitgeschichte waren. Christian Rathner, der Sendungsverantwortliche des
Religionsmagazins, stellte gemeinsam mit Doris Appel das neue
"Orientierung"-Studio vor. Ab Sonntag, dem 31. Oktober, präsentiert sich das
Magazin um 12.30 Uhr in ORF 2 in neuem Outfit, neuem Studio und neuer Grafik. Für
besondere Geburtstagswünsche sorgten die Rounder Girls, die den Festgästen heiße
Rhythmen und Gospels präsentierten.
mehr Infos ...
Letztes Update dieser Seite am 11.07.2006 um 10:42 von Marcus Marschalek