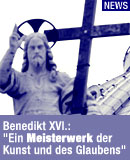
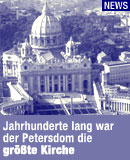
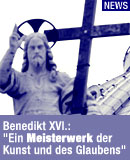 |
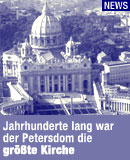 |
|
News 18. 04. 2006 |
Grundsteinlegung des Petersdoms vor 500 JahrenAm 18. April 1506 legte Papst Julius II. den Grundstein für den Neubau der Peterskirche. Allerdings erst 120 Jahre später wurde das architektonische Gesamtkunstwerk vollendet. Berühmte Künstler wie Bramante, Raffael oder Michelangelo arbeiteten an dem Renaissance-Bau. Jahrhunderte lang war der Petersdom die größte Kirche der Welt.Am 18. April 1506 erfolgte die Grundsteinlegung für den neuen Petersdom durch einen der tatkräftigsten, aber auch kriegerischsten Päpste der Kirchengeschichte, Julius II. (1503-13). 18 Päpste nach ihm führten den Bau fort, bis 1615 unter Paul V. die Fassade fertig war und schließlich 1626 die Schlussweihe erfolgte. Ein Dutzend Baumeister und Architekten - darunter Genies wie Bramante, Raffael oder Michelangelo - leiteten die Arbeiten, kämpften gegen Probleme der Statik und des Geldmangels. Und immer wieder mussten sie ihre künstlerischen Pläne und mitunter exzentrischen Ideen den Vorgaben ihrer geistlichen Auftraggeber anpassen. Ein einsturzgefährdeter AltbauRund 50 Jahre lang hatten die Päpste des 15. Jahrhunderts versucht, durch vielfältige Restaurierungen die alte Petersbasilika zu retten, die Kaiser Konstantin um 320 über dem Petrusgrab errichtet hatte. Nach 1.100 Jahren war die Basilika baufällig. Insbesondere die Apsis im vorderen Teil drohte abzurutschen - dort, wo Konstantin einen Teil des Vatikanhügels abtragen und einen Abhang mit Erde auffüllen ließ, damit die Basilika exakt über dem Petrusgrab stand. Um die Setzungen abzufangen, hatte Papst Nikolaus V. nach 1450 bereits massive Bauten für einen neuen Chor im Westen der Kirche begonnen. Kritik am päpstlichen PrestigeprojektDa diese und andere aufwendige und kostspielige Stützbauten ohne die erhoffte Wirkung blieben, entschloss sich der energische Julius II. schließlich zum Neubau - mit vielen Ideen, aber ohne fertigen Bauplan. Es fehlte nicht an Kritikern, die den altehrwürdigen Bau unbedingt retten wollten. Sie stellten die Notwendigkeit eines Neubaus in Frage und sprachen von einem päpstlichen Prestigeprojekt, in dem Julius II. sein eigenes geplantes Grabmonument wirkungsvoll unterbringen wollte. Bramante - "Ruinante"Der von Julius in den Vatikan gerufene Baumeister Donato Bramante entwarf ein erstes Projekt, nicht zur Begeisterung der Kurie, die sich der alten Basilika verbunden fühlte. Dieser Entwurf sah einen reich untergegliederten Zentralbau mit Kuppel von der Größe jener des Pantheon, vier Nebenkuppeln und zwei Türmen vor. Die Hauptkuppel sollte das Himmelsgewölbe und die geistige Einheit der katholischen Kirche symbolisieren, der gesamte Baukörper die päpstliche Macht als Zentrum des Universums. Die Grabkapelle des Apostels Petrus wurde mit Tuffsteinblöcken umbaut, dann erfolgte der Abriss der Konstantinischen Basilika ohne Rettung antiker Mosaiken oder der Dekorationen aus dem Mittelalter. Dies trug Bramante die boshafte Bezeichnung "Ruinante" (Demolierer) ein. Ablassgeld für den PetersdomZunächst schritt der Bau bis zu den Bögen zwischen den Pilastern rasch voran, dann kam es wegen statischer Probleme und der gewaltig gestiegenen Baukosten, die die päpstlichen Finanzen belasteten, zu Verzögerungen. Deshalb appellierte Julius 1513 an die ganze Christenheit, das Projekt gegen Gewährung eines Ablasses finanziell zu unterstützen, was einer der Anstöße für die protestantische Bewegung unter Martin Luther werden sollte. Raffael – ein überlastetes GenieBramante starb 1514, Giuliano da Sangallo und der bautechnisch erfahrene Dominikanermönch Fra Giocondo behoben Unzulänglichkeiten bei den Pfeilerkonstruktionen. Im gleichen Jahr 1514 wurde Raffael Santi, der bis dahin die Stanzen (Päpstliche Gemächer im Vatikan) mit Fresken ausgemalt hatte (während Michelangelo zeitgleich die Deckenfresken der Sixtinischen Kapelle schuf), Bauleiter von St. Peter. Auf Wunsch des neuen Papstes Leo X. (1513-21) wurde Bramantes Projekt eines griechischen Kreuzes als Grundform durch das eines lateinischen Kreuzes abgeändert, zu seiner Verwirklichung kam es nicht, da Raffael bis zu seinem Tod 1520 mit zahlreichen anderen Tätigkeiten überlastet war. Langsamer BaufortschrittUnter Raffaels beiden Nachfolgern als Bauleiter, Baldassare Peruzzi (bis 1537) und Giulianos Neffe Antonio da Sangallo (bis 1546) ging der Bau wieder nur schleppend weiter, ständig mussten Fundamente, Pilaster und Bögen zwischen letzteren verstärkt werden. Sangallos neues Projekt schloss sich jenem Bramantes an, allerdings mit einer aufwändigen Fassade zwischen zwei riesigen Glockentürmen. Es wurde von Papst Paul III. (1534-49) trotz Protesten genehmigt. Michelangelo wollte "einzig zur Ehre Gottes" arbeitenNach Sangallos Tod 1546 betraute Paul III. den damals bereits 71 Jahre alten Michelangelo mit der Bauleitung. Sein Projekt kehrte zum Zentralbau, jedoch in gedrungeneren Formen zurück, wobei die Apsiden starken Anteil an der Gesamtwirkung des Raumes gewannen. Überhaupt versah Michelangelo die Architektur mit einem neuen Raumempfinden. Der universale Künstler (Architekt, Bildhauer, Maler, Dichter) wollte St. Peter unentgeltlich "einzig zur Ehre Gottes, des Heiligen Petrus und zum Heil der eigenen Seele" schaffen. Statik widersprach Michelangelos KuppelplänenInspiriert von der Florentiner Domkuppel Filippo Brunelleschis (15. Jahrhundert) entwarf Michelangelo eine auf einem zylindrischen Tambour aufsitzende halbkugelförmige Kuppel für den Petersdom. Gegen Ende seines Lebens verlangsamte sich der Dombau wieder, nach seinem Tod 1564 vollendete Baldassare Borozzi (nach seinem Geburtsort Vignola genannt) das in Nord-Süd-Richtung ausgerichteten Querhaus und den Kuppeltambour. Michelangelos Halbrund-Kuppel ließ sich aus statischen Gründen nicht verwirklichen. Nach Vignolas Tod 1573 vollendete Guglielmo della Porta 1588-90 die Kuppel in modifizierter Form und mit kleinerer Laterne als von Michelangelo geplant. Der Hohlraum zwischen äußerer und innerer Kuppelschale wurde vergrößert, indem die äußere Schale überhöht, die innere halbkugelförmig und damit flacher gestaltet wurde, ansonsten folgte die Außengestaltung Michelangelos Plan. Griechisches oder lateinisches KreuzBeim Tod des tatkräftigen Papstes Sixtus V. (1585-90) waren die große Apsis, das Querschiff und die Kuppel über der Vierung fertig, es fehlte noch der Vorderteil des Domes nach dem Plan Michelangelos. Eine der entscheidenden Fragen beim Bau des Petersdoms war, ob der Grundriss der neuen Basilika einem griechischen Kreuz oder einem lateinischen Kreuz entsprechen sollte: Ob er vier gleich lange Arme und Seitenschiffe haben sollte, oder ob - wie die frühchristliche, "lateinische" Basilika - das Hauptschiff länger sein sollte. Michelangelo favorisierte den Zentralbau. Papst Paul V. (1605-21) ließ jedoch Michelangelos Plan wieder abändern: der Grundriss der Basilika sollte die Form eines lateinischen Kreuzes erhalten - der Zentralbau also zum Langhausbau werden. Fassade wurde 1614 vollendetMit den Änderungen wurde Carlo Maderna betraut, ein Neffe von Domenico Fontana, der 1586 den Obelisk auf dem Petersplatz aufgestellt hatte. 1607-14 erbaute Maderna den neuen Vordertrakt der Basilika und gestaltete den noch heute bewunderten Innenraum - ein großes Mittelschiff, flankiert von offenen Pfeilerreihen und diesen aufsitzenden Bögen, zwischen denen sich ein mächtiges Tonnengewölbe spannt. Die Vorhalle entwarf Maderna als einfachen Säulengang entlang der Fassade, bei der 1614 vollendeten Fassadengestaltung erreichte er aber nur Mittelmaß. Bernini prägte die Innendekoration des DomsSchon vor der Schlussweihe 1626 unter Papst Urban VIII. hatten die Päpste sich Gedanken über die Innendekoration des neuen Domes gemacht. Hier sollte der von Urban VIII. 1624 in den Vatikan berufene Neapolitaner Lorenzo Bernini (1598-1680) federführend werden. Unter Innozenz X. (1644-55) verlor Bernini an Gunst, nachdem ein in Bau befindlicher Glockenturm von St. Peter wegen statischer Fehler eingestürzt war. Alexander VII. (1655-67) setzte Bernini wieder in seine alten Rechte ein. Er schuf nun der Reihe nach die Kathedra und Gloria für die Apsis, die Kollonaden auf dem Petersplatz, zwei Brunnen auf dem Platz, die Scala Regia von den Vatikanischen Palästen in den Dom, das Grabmal Alexanders VII., sowie das Ciborium (Aufbau über dem Sakramentsaltar). Dem Einfluss Berninis konnte sich keiner der später in der Peterskirche tätigen Künstler, besonders bei Skulpturen und Grabdenkmälern, entziehen. Als letztes bedeutendes Kunstwerk ist im 20. Jahrhundert das Bronzetor von Giacomo Manzu hinzugekommen. Jahrhunderte lang die größte KircheAls der mit der Schlussweihe 1626 abgeschlossene Dombau schließlich vollendet war, hatte die Christenheit die größte Kirche der Welt erhalten. Die Abmessungen: Bodenfläche 15.160 Quadratmeter, äußere Länge mit Vorhalle 211,5 Meter, innere Länge 187 Meter, Innenhöhe 46,2 Meter, Außenhöhe bis zur Kuppelspitze 132,5 Meter, Kuppeldurchmesser 42 Meter, Fassadenbreite 114,5 Meter, Fassadenhöhe 45,5 Meter, Breite des Vorplatzovals 240 Meter. Den Titel als größte Kirche der Welt büßte die Peterskirche erst 1990 ein: In diesem Jahr wurde die nach ihrem Vorbild gebaute und noch größere Basilika Notre-Dame de la Paix in Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) eingeweiht. Benedikt XVI.: "Meisterwerk der Kunst und des Glaubens"Papst Benedikt XVI. rief die Gläubigen am Montag in Erinnerung an die Grundsteinlegung vor 500 Jahren auf, "lebendige Steine" der katholischen Kirche zu sein. "Möge dieser glückliche Jahrestag in allen Katholiken den Wunsch wecken, lebendige Steine für den Bau der heiligen Kirche zu sein", sagte der Papst am Montag in seiner Residenz Castel Gandolfo mit Blick auf den am 18. April 1506 begonnenen Bau des Petersdoms. Der Papst würdigte den Renaissance-Bau als außergewöhnliches "Meisterwerk der Kunst und des Glaubens". Der Dom werde in der ganzen Welt für die "mächtige Harmonie seiner Formen" bewundert, betonte der Papst.
Fotos:
|
|
|